Oldenburger Forschungen, Band 25
Oldenburger Forschungen, Band 24
Die Erinnerungen von Johannes Ramsauer, evangelische Kirchenpolitik im 19. Jhd in Oldenburg
Oldenburger Forschungen, Band 23
Geschichte des Naturschutzes im Land Oldenburg 1880 - 1934
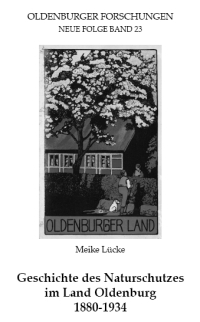
Gemeinhin gilt für Deutschland die 1871 einsetzende Hochindustrialisierung als Auslöser für die Heimat- und Naturschutzbewegung der Jahrhundertwende. Ernst Rudolff und Hugo Conwentz werden als die Väter der deutschen Naturschutzgeschichte gewürdigt. Doch wie stellen sich die Anfänge des Naturschutzes auf regionaler Ebene dar?
Die Geschichte des Naturschutzes im Land Oldenburg 1880 - 1934 dokumentieren die Anfänge des Naturschutzes in einem agrarisch geprägten Kleinsaat des Deutschen Reiches. Eine Bestandsaufnahme der im Landesteil Oldenburg am Naturschutz beteiligten Personen und Organisationen, ihrer Argumente und Konflikte, der Schutzelemente und -maßnahmen sowie der schutzwürdigen Objekte gibt Auskunft über die Wurzeln der Naturschutzbestrebungen im Oldenburger Raum.
Oldenburger Forschungen, Band 22
50 Jahre am Oldenburger Hof
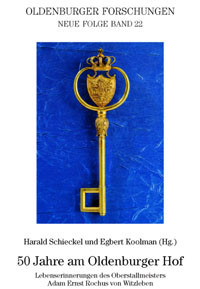
Adam Ernst Rochus v. Witzleben (1791-1868), der Sohn des oldenburgischen Kammerherrn und Schlosshauptmanns Rochus Friedrich Otto v. Witzleben, verlebte seine Kindheit in Eutin, später in Plön. Hier amtierte sein Vater als Hofchef, in Wirklichkeit als Aufseher des psychisch kranken und regierungsunfähigen Herzogs Peter Friedrich Wilhelm v. Holstein-Oldenburg.
Bis zu seinem 19. Lebensjahr galt Adam Ernst Rochus v. Witzleben als zukünftiger Erbe der Familiengüter Hude und Elmeloh, die der ältere Bruder des Vaters bewirtschaftete. Mit der späten Geburt eines Sohnes auf Hude veränderte sich der Lebensplan des Knaben.
Nach der Teilnahme als freiwilliger Offizier an den Feldzügen gegen Frankreich 1813 und 1815, zuerst in der Russisch-deutschen Legion, dann im oldenburgischen Infanterie-Regiment, erlangte Rochus von Witzleben bald und zwar in der höfischen Funktion als Kammerjunker, eine besondere Vertrauensstellung bei Herzog Peter Friedrich Ludwig. Er dient diesem als Reisebegleiter, ohne dass ihm die formelle Funktion eines Reisemarschalls übertragen wurde. Auch dem Regierungsnachfolger Großherzog Paul Friedrich August diente Rochus v. Witzleben bis zu dessen Tod als Kammerherr und Oberstallmeister und begleitete diesen auf zahlreichen Reisen. Die plastischen und farbigen Mitteilungen des Verfassers über die Pseudo-Hofhaltung des kranken Herzogs Peter Friedrich Wilhelm in Plön und von seinen Erlebnissen am Oldenburger Hof verdienen, auch wenn sie naturgemäß nicht von ausgeprägter Kritik geleitet sind, wegen ihrer Authentizität und nicht zuletzt auch wegen ihres gelassenen Humors die Aufmerksamkeit des Lesers. Die Erinnerungen des Hofbeamten Rochus v. Witzleben sind es jedenfalls wert, bei der künftigen Geschichtsschreibung über das 19. Jahrhundert in Oldenburg beachtet zu werden.
Oldenburger Forschungen, Band 21
Das Moor von Sehestedt Landschaftsgeschichte am östlichen Jadebusen

Weit über den Jaderaum hinaus ist das Sehestedter Außendeichsmoor als einzigartiges Naturdenkmal bekannt. Nirgendwo sonst in Europa gibt es noch ein Moor, das dem unmittelbaren Angriff der See ausgesetzt ist. Vor allem ist es aber das Phänomen des Aufschwimmens bei hohen Sturmfluten, das dieses Moor kennzeichnet und es so bedeutsam macht. Deshalb wird dieses Moor auch häufig Schwimmendes Moor genannt. Mehrfach sind in früherer Zeit große Moorstücke mit Häusern darauf abgerissen und weit vertrieben worden. Über ähnliche Ereignisse von anderen Teilen der Nordseeküste berichten alte schriftliche Quellen, die hier zusammengestellt werden.
Dieses Moor hat seit langem das Forschungsinteresse auf sich gezogen. Insbesondere das Niedersächsische Institut für historische Küstenforschung in Wilhelmshaven, das der Autor lange Jahre geleitet hat, hat hier und in dessen Umland intensive Untersuchungen betrieben. Hinzu kommen jahrzehntelange Beobachtungen zum Abbruch und zu anderen Veränderungen des Moores.
Neben seiner Hauptbedeutung als geologisches Denkmal besitzt das Moor auch eine sehr interessante und schützenswerte Pflanzen- und Tierwelt. Dabei ist es vor allem bedeutsam als Rest eines einstmals riesigen Hochmoores, das inzwischen fast vollständig kultiviert ist.
In dem Band wird die Entwicklungsgeschichte des Moores, eingebettet in die Geschichte des Jaderaumes, dargestellt. Der Schwerpunkt liegt jedoch auf der Dokumentation des Abbruchs und der Flächenentwicklung während der letzten Jahrhunderte, die mit vielen farbigen Abbildungen und zahlreichen zusätzlichen Grafiken und Karten vorgelegt wird.
Wesentliche Teile des Bandes widmen sich den alten Kultivierungsmaßnahmen, z.B. dem sogen. Kleischießen, das in großen Teilen des Schweier Moores betrieben wurde, von dem das Sehestedter Moor ein Teil ist. Auch die Deichbaugeschichte wird eingehend behandelt; wegen der mehrfach vorgekommenen Grundbrüche gab es hier bis in die jüngste Zeit erhebliche Deichbauprobleme. Aus diesem Grund wurden vom oben genannten Institut zahlreiche Bohrungen durchgeführt, die hier mit ausgewertet wurden.
Wegen des Angriffs der See sind die Tage diese Moores gezählt; es wird dieses Jahrhundert sicher nicht überdauern. Deshalb begegnet diese Monographie nicht nur dem aktuellen Interesse, sondern dokumentiert die heute nur noch hier zu beobachtenden Phänomene und erhält sie damit für die Nachwelt.
Oldenburger Forschungen, Band 20
Die Kultivierung der Nordwestdeutschen Hochmoore

Kaum eine Landschaft Mitteleuropas hat in einem so kurzen Zeitraum eine so tiefgreifende Umwandlung erfahren wie das Hochmoor. Über Jahrhunderte hinweg entzog es sich dem Zugriff des Menschen, war der Inbegriff des Unheimlichen und galt als ein kaum zu überwindendes Hindernis für den Zugang der Kultur. Im Nordwesten Deutschlands waren die Hochmoorgebiete so weitläufig, dass sie Bergketten oder Ozeanen gleich Landschaften und ihre Bevölkerung voneinander abgrenzten. In dem rings von Hochmooren umgebenen Saterland z. B. bildeten sich angesichts der abgeschnittenen Lage Eigenarten in der Sprache und den Sitten heraus, die im Verlauf des 19. Jahrhunderts die Aufmerksamkeit zahlreicher Landes- und Volkskundler auf sich zogen und auch die Neugier von Reisenden und Publizisten weckten.
Bis weit in die Neuzeit hinein blieben die großflächigen Hochmoorkomplexe Nordwestdeutschlands nahezu siedlungsfrei, auch wenn sie in den Randbereichen bereits recht früh zur Brennstoffgewinnung genutzt wurden. Dennoch galten die weiten, unerschlossenen Hochmoorareale lange Zeit als Niemandsland, wobei eine Kartierung dieser Gebiete oftmals erst im Zusammenhang mit Grenzstreitigkeiten zwischen einzelnen Territorien oder auch zur Klärung von Nutzungsrechten zwischen den angrenzenden Gemeinden erfolgte.
Oldenburger Forschungen, Band 19
Führungsschichten im Jeverland

Die friesischen Häuptlinge haben seit jeher die Phantasie der Leute und seit langem auch die wissenschaftliche Forschung beschäftigt. Durch Darstellungen verschiedenster Art sind die hervorragenden Persönlichkeiten und die mächtigsten Familien auch einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden. Es gab aber ursprünglich noch zahlreiche weitere Familien, die an der Führung des Landes beteiligt waren. Es galt, auch diese ins Bewusstsein zu rücken und für möglichst viele Familien eine Vorstellung von der Größe ihres Besitzes und ihrer sozialen Stellung zu gewinnen. Dabei werden die im Laufe des Mittelalters erfolgten Wandlungen sowie die Unterschiede zwischen den Landesteilen Östringen, Wangerland und Rüstringen deutlich. Das Selbstbewusstsein dieser Familien wird auch in ihren Wappen sichtbar, von denen einige hier erstmals farbig abgebildet werden konnten.
Oldenburger Forschungen, Band 18
Die Bentincks
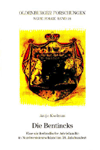
Eine niederländische Adelsfamilie in Nordwestdeutschland im 18. Jahrhundert, ca. 200 Seiten, 8 Farblithos, 2003, brosch.
Oldenburger Forschungen, Band 17
Ein Diener seines Herrn

Die Lebenserinnerungen von Johann Dietrich Wilkens, Leibkammerdiener des Großherzogs Paul Friedrich August von Oldenburg, 118 Seiten, 40 s/w Lithos, brosch., 2002.
Oldenburger Forschungen, Band 16
Die Pflanzenwelt im Oldenburger Land
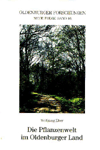
232 Seiten, 20 s/w Abb., 116 farbige Abb., 2001, brosch.

