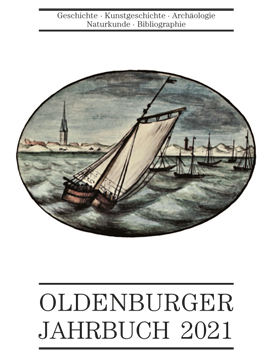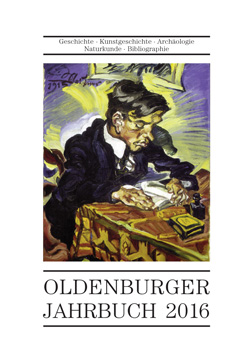Am Donnerstag, 4. Dezember 2008 um 17.00 Uhr fand die Präsentation des
Oldenburger Jahrbuch 2008
statt.
Des neuen, des jetzt vorzustellenden Oldenburger Jahrbuchs brauchen sich seine Ahnen nicht zu schämen. Es erweist sich ihrer würdig im Inhalt und ähnelt ihnen in Umfang und Form. Mit 386 Seiten liegt es im Schnitt der letzten Jahre, im Hauptteil, nämlich auf 237 Seiten, wie immer historisch, dann auf gut 20 Seiten archäologisch, auf den folgenden 50 Seiten naturkundlich. Es folgen obligatorisch die Bibliographie und die Berichte.
Beginnen wir mit der Bibliographie. Die gibt es inzwischen doppelt. Der heute im Jahrbuch präsentierte Teil weist 900 Publikationen des vergangenen Jahres nach (soviel wird über Oldenburg geschrieben!) und dient der (relativ) raschen Information über diese Neuerscheinungen insgesamt oder zu den jeweils interessierenden Themengebieten. In der Landesbibliothek sind wir aber seit einiger Zeit dazu übergegangen, diese Titel in einer Datenbank zu erfassen und retrospektiv zu ergänzen. Über 16.000 Bücher und Aufsätze aus den letzten 20 Jahren sind dort mittlerweile schon in einer Suche abfragbar. Das wird wachsen und wer jetzt, aber auch und gerade später einmal sich kundig machen will über zeitgenössische Planungen und Einschätzungen des JadeWeserPorts, wer einen vollständigen Überblick haben will über die fast unübersehbare Zahl der Publikationen über den Grafen Galen oder wer sich von der Lektüre des aktuellen Jahrbuchs anregen lässt und nach weiteren Kriegerdenkmalen im Oldenburgischen sucht, wird hier langfristig bedient. Vieles wird überhaupt nur via Bibliographie tradiert. Schauen Sie doch bitte mal auf die Homepage der Landesbibliothek. Dort gibt es einen Link Oldenburgische Bibliographie.
Doch nun zum chronologisch geordneten historischen Teil des Jahrbuchs. Heinz A. Pieken führt uns ins tiefe Mittelalter. Ausgehend von einer Urkunde von 1063 macht er plausibel, warum die Lokalisierung von Ascbrok und Stoltenbrok Gegenstand ein und desselben Aufsatzes sein kann und muß. Dazu widmet er sich vor allem der Neubestimmung der geographischen Lage des Ascbroks. Den suchte man bisher in der Regel links der Weser zwischen Elsfleth und Altenesch. Dagegen wendet sich der Aufsatz mit höchst differenzierten historischen, sprachwissenschaftlichen, geographischen und archäologischen Argumenten. Weder die sprachhistorische Untersuchung des Namens Ascbrok noch die geographische und landschaftsgeschichtliche Bestimmung der historischen Begrifflichkeiten der Urkunde bieten zwingende Gründe, den Ascbrok auf dem linken Weserufer anzusiedeln. Vielmehr bezeichnete er ein Gebiet bei Aschwarden rechts der Weser, das vermutlich bald nach 1085 kolonisiert wurde, zu welcher Beweisführung auch Plinius und Ptolemäus zu Rate gezogen werden. Nach den Stedingerkriegen übernahm den dort schon bestehenden Herrensitz ein Graf von Stotel, der sich von "Stoltenbroke" nannte und damit einem Teilbereich des Ascbroks für kurze Zeit diesen Namen gab. Bedauerlich, dass das Ergebnis der Untersuchung ihren Gegenstand aus dem Geltungsbereich des Oldenburger Jahrbuchs herausgeführt hat.
Nicht zentral oldenburgisch ist auch der folgende Aufsatz von Thomas Vogtherr, der die "Stauferzeit in Niedersachsen" einige Jahrzehnte später ins Visier nimmt, "vom Konflikt zweier Mächtiger, einer Liebesheirat unter ihren Nachkommen und dem gefangenen König im Turm" handelt, welch beiden letzteren Punkte ich gerne Ihrer Lektüre überlasse; die Mächtigen sind seit der Königswahl von 1138 die königlichen Staufer und die königsgleichen Welfen in Sachsen, insonderheit die Staufer Konrad und Friedrich Barbarossa und Heinrich der Löwe auf welfischer Seite, die aber keineswegs, wie ein langgehegter Topos der Forschung behauptet, sich ausschließlich in herzlicher Feindschaft gegenüberstanden, sondern auch Zeiten großen Einverständnisses erlebten. Nach der Gefolgschaftsverweigerung freilich verlor Heinrich 1180 seine Reichslehen, der welfische Herzogsanspruch aber blieb erhalten und fand seine Erfüllung schließlich 1235 mit der Ernennung des Welfen Otto zum Herzog von Braunschweig und Lüneburg durch den Staufer Friedrich II.Die Stauferzeit in Niedersachsen seit 1138 war immer auch Welfenzeit. Heinrich der Löwe drückte Norddeutschland seinen Stempel auf, Niedersachsen war zum mindesten königsfern, wenn nicht königsfeindlich; die Territorienbildung vollzog sich unter welfischer Dominanz oder in bewusster Gegnerschaft zu den Welfen. In den Jahren nach 1180 emanzipierten sich die Grafenfamilien, die Randgebiete im Westen des heutigen Bundeslandes erhielten - etwa in Gestalt des Oldenburger Herrschaftsgebiets - ein neues Gesicht.
Nun in die nähere Heimat, nach Friesland. In der Uffenbach-Wolfschen Gelehrtenbriefsammlung in Hamburg hat Matthias Bollmeyer "Ein frühes Dokument zum Schulleben an der Lateinschule in Jever. Ein lateinisches Zeugnis aus dem Jahr 1587" - so der Titel des Aufsatzes - gefunden. Er beschreibt das Blatt, bildet es ab, druckt seinen Text, den er übersetzt und analysiert. Verfasser des Zeugnisses, möglicherweise das älteste überlieferte Empfehlungsschreiben zur Fortsetzung einer akademischen Laufbahn, ist der Magister Gerhard Sartorius, der Rektor der Lateinschule. Der Empfänger des Zeugnisses, ein freundlicher und kluger, leider aber bettelarmer junger Mann, ist nicht mit Sicherheit zu identifizieren.
Um eine Schule kümmert sich auch Matthias Nistal, um eine jüngere allerdings, nämlich um "Die Anfänge der Cäcilienschule als großherzoglich-private höhere Töchterschule", 1836 von Paul Friedrich August unter dem Namen seiner dritten Ehefrau mit 20 Schülerinnen gegründet, finanziell ausgestattet von Prinz Constantin Friedrich Peter aus der russischen Linie des Hauses Oldenburg, der damit der weiblichen Jugend der herrschaftlichen Zivil- und Militärbeamten der Residenz eine Bildungsstätte bieten wollte und diesen Focus auf die Honoratiorentöchter nur zögernd erweiterte. Nistal beschreibt Unterrichtsfächer - alte Sprachen, die Voraussetzung für die Aufnahme eines Studiums waren, waren nicht darunter -, Lehrerinnen und Lehrer, darunter Elise Lasius und der Prinzenerzieher Johannes Ramsauer, und Schwierigkeiten, die wir von uns selbst und unseren Kindern kennen: mangelnden Eifer, fehlende Hausaufgaben, Unpünktlichkeit, unentschuldigtes Fehlen, schließlich auch "Ausgelassenheit", - wobei einige dieser Verhaltensweisen auch dem Lehrkörper attestiert werden. In den 50er Jahren des 19. Jahrhunderts geriet die Schule in die Krise, häuften sich Schwierigkeiten mit den Schülern und deren Eltern, denen beizukommen ihr soziales Prestige verbot, Schwierigkeiten innerhalb des Lehrkörpers und zwischen ihm und der Aufsichtsbehörde. Finanzielle Engpässe machten der großherzoglichen Schule schließlich - 1857 - den Garaus. Erst 10 Jahre später wurde sie wiederbegründet, jetzt in städtischer Regie.
In ähnlichem zeitlichen Rahmen bewegt sich Kadja Grönke, die erste Ergebnisse einer umfangreichen Forschungsarbeit zu einem bedeutenden Oldenburger Hofkapellmeister präsentiert: "August Pott (1806-1883) und die großherzogliche Hofkapelle in Oldenburg". War die Kritik an der Bevorzugung höherer Bürgertöchter in der Cäcilienschule schon innerbürgerlich, Indiz sich verbreitenden bürgerlichen Selbstbewußtseins nach 1848, so steht August Pott in einem anderen Feld noch in anderem Emanzipationszusammenhang, wenn man so will: Er setzte sich ein für die Gleichberechtigung adelig-fürstlicher und bürgerlicher Musikausübung. Geb. in Northeim bei Hannover stieg der Sohn eines Stadtmusikanten als hochtalentierter Geiger sehr rasch zum Hofbediensteten in Hannover auf, begnügte sich allerdings nicht damit, sondern setzte seine Ausbildung bei dem zeitgenössisch berühmten Kasseler Hofkapellmeister und Violinvirtuosen Louis Spohr fort, wurde damit Meisterschüler einer allseits anerkannten musikalischen Autorität. Die beginnende Solokarriere tauschte Pott aber gegen eine Festanstellung, Lebenssicherheit für sich und die Familie wünschte er und Sozialprestige. 1832 zum Hofkapellmeister in Oldenburg ernannt, beackerte August Pott das spätestens seit der Franzosenzeit brachliegende Oldenburger Musikleben, indem er zunächst einmal das Ensemble zusammenstellte, als dessen Meister er engagiert worden war und mit dessen Musik er dann eben nicht nur den Hof und dessen geladene Gäste erfreute, sondern nach durchaus schwierigen Verhandlungen auch zur Veranstaltung öffentlicher Konzerte die Berechtigung erhielt, deren Repertoire und Qualität Ausführenden wie Hörern einiges abverlangte und deren Niveau durch die umfassenden Herrschaftsrechte des Meisters über seine Hofkapelle gesichert werden sollte, was eine Fülle heute in dicken Konvoluten überlieferter Konflikte allerdings nicht vermeiden konnte. Ich bin mir nicht sicher, ob es angemessen ist, bei der Lektüre einer beispielhaft geschilderten Auseinandersetzung mit einem Orchesterposaunisten, angesichts derer Pott beim alten Mentor Spohr um Rat bat, viel Vergnügen zu wünschen. Potts künstlerischer Anspruch und sein ausgeprägtes Ehr- und Standesbewusstsein haben ihm die Arbeit nicht erleichtert, 1861 ging er in den Vorruhestand und verließ Oldenburg eilends.
Aller Überleitungsversuch ist vergeblich seine Vielfalt ist ja eine der Stärken des Jahrbuchs - zum Aufsatz von Georg Götz: "Der Typus der Ringpfeilerhalle als Kriegerdenkmal im Oldenburger Land", der den Untersuchungsgegenstand in einen kunstgeschichtlichen und einen sozialgeschichtlichen Kontext stellt. Kriegerdenkmäler waren gerne auch Siegesdenkmäler, eine zusätzliche Sinnstiftung allerdings, die nach 1918 bekanntlich verwehrt blieb. Doch der Ehre sollte gedacht werden; es entstanden Ehrenmale in Wilhelmshaven-Rüstersiel, Oldenburg-Eversten und Varel. Sie gingen auf Initiativen von Vereinen zurück, sind von Architekten aus dem Oldenburgischen entworfen und von lokalen Handwerkern an markanten Stellen errichtet. Die anschaulich bebilderte Beschreibung der Denkmäler macht Unterschiede und Gemeinsamkeiten deutlich, die auch die Eröffnungsfeiern durchziehen, denen freilich ein wie es heißt "militärischer Grundton" eignete, mit abnehmender Tendenz: in Rüstersiel 1922 mit revanchistisch-nationalistischem Einschlag unter Ausschluß der Sozialdemokratie, in Eversten 1925 mit Stahlhelm und Reichsbanner Schwarz Rot Gold unter Betonung des August-Erlebnisses 1914, ebenso in Varel 1927 unter maßgeblicher Beteiligung Geistlicher beider Konfessionen mit Betonung des mahnenden Charakters des Baus.
Geistliche spielen auch im letzten historischen Aufsatz des diesjährigen Bandes eine Rolle, sind dessen Thema: "Mit den Vertriebenen kamen Geistliche". Michael Hirschfeld beschreibt "Erinnerungen schlesischer Priester an ihre Aufnahme im Oldenburger Land nach dem Zweiten Weltkrieg" wie es im Untertitel heißt. Sechs ostvertriebene katholische Geistliche stellt er kurz biographisch vor und lässt sie meist autobiographisch Einstellungen und Handeln in der Fremde präsentieren, sowohl in der Diaspora wie auch im Oldenburger Münsterland. Die Erfahrungen, die die 6 auch ganz unterschiedlichen Charaktere (von insgesamt ca. 40, die es ins Oldenburgische verschlagen hatte) machten, waren ambivalent, unterschiedlich, reichten von großer Zufriedenheit bis zum bleibenden Gefühl von Fremdheit und Zurücksetzung und waren für zupackende Pragmatiker im Norden nicht schlechter als im Süden. Mußten wir uns das letzte Jahr mit einer nur knappen Bücherschau begnügen, so finden wir heuer wieder einen ausführlichen Rezensionsteil. Auf knapp 40 Seiten liefert das bewährte Team Einschätzungen von gut ebenso vielen Neuerscheinungen über Oldenburg und angrenzende Landstriche und wird dabei von einer namhaften Zahl Auswärtiger unterstützt.
Wir verlassen nun den historischen Sektor und finden im archäologischen Teil zwei Aufsätze von Jana Esther Fries. Kurz gewährt sie uns "Ungeahnte Einblicke", denn: "Die Sanierung der Lambertikirche legt ein Stück des spätgotischen Baus offen". Überraschend wurde bei dem Versuch, einen Fahrstuhl zu grundieren, eine mittelalterliche Mauer entdeckt, nur noch unterirdisch vorhandener Teil der spätgotischen dreischiffigen Hallenkirche, die Ende des 18. Jahrhunderts der grundlegenden klassizistischen Umgestaltung zum Opfer gefallen ist. Frau Fries setzt dankenswerterweise eine von ihrem Vorgänger Jörg Eckert begonnene und jahrelang gepflegte Tradition fort.
Auch das Jahrbuch 2008 enthält wieder den Bericht der archäologischen Denkmalpflege über das verflossene Jahr und bietet eine Auswahl der Geländetätigkeit der Archäologen. 15 Grabungen zwischen Wilhelmshaven und Nordhorn werden beschrieben, die wichtigsten Veröffentlichungen genannt.
Der Übergang zum Teil III des Jahrbuchs führt mich auf schwankenden Grund, auf dem allein der Kollege Ritzau als dessen Betreuer festen Boden unter den Füßen hat. Und das sogar im Ipweger Moor. Diese Gegend ist mir als sonnige Fahrradtour mit anschließendem Café-Besuch wohlvertraut; sie bietet jedoch offensichtlich weitere interessante Aspekte. Um einen davon, ums "Vorkommen der Moltebeere im Ipweger Moor" hat sich Ummo Lübben gekümmert. Diese Zwergbrombeerart ist im Norden der Erdkugel weit verbreitet, in Mitteleuropa aber sehr selten und mit der Entwicklung von Früchten, die das Auftreten beider Geschlechter nebeneinander voraussetzt, im Ipweger Moor deutschlandweit einmalig. Sie wurde erst 1913 in der damals noch fast unzugänglichen Gegend entdeckt und ist jetzt durch Düngerstaub und Moorkultivierung, die Wasser entzieht, gefährdet. Wiedervernässung und die Veränderung der Artenzusammensetzung in der Nähe sollen dem entgegenwirken.
Und nun zu den Schülern und Schülerinnen. Was die alles wissen und können! "EVI ein neues Verfahren zur Flechtenkartierung" stellen Simon Orth und Stephan Hacker in einer Arbeit vor, die der Landesverein im Wettbewerb "Schülerpreis für Regionalforschung 2007" mit dem 1. Preis ausgezeichnet hat. Messungen der Luftqualität durch Bioindikatoren sind nicht nur kostengünstig, sondern haben darüber hianus den Vorteil, statt der Erfassung einzelner Schadstoffe die Auswirkung der Gesamtheit aller Schadtsoffe auf den Organismus darzustellen. Die häufig vorkommenden sog. Epiphytischen Flechten besitzen die Fähigkeit, Veränderungen der Luftqualität zuverlässig anzuzeigen. Die beiden Autoren stellen mit EVI, dem Empfindlichkeits-Vielfalts-Index, wie sie das Verfahren nach seinen beiden wesentlichen Faktoren genannt haben, eine neue Auswertungsmethode der Flechtenkartierung vor, die sich besonders gut zur Luftgütebestimmung in Nordwestdeutschland eignet, beschreiben das Verfahren und seinen erfolgreichen Test in Westerstede, wo damit sogar die Luftqualitätsunterschiede zwischen den Zufahrtsstraßen und der verkehrberuhigten Innenstadt deutlich werden. Dem Wunsch, durch weitere Kartierungen die Datengrundlage über die Luftverschmutzung im Nordwesten zu vergrößern und als Basis für Maßnahmen zum Umweltschutz zu verwenden, kann man sich nur von Herzen anschließen.
Den 2. Preis des Wettbewerbs erhielten Christina Kronenberg, Marielouise Sander und Kim Tappe für ihre Untersuchung "Die jährliche Invasion der "blauen Giftzwerge" Algenblüten im Banter See". Toxische Wasserblüten, verursacht durch die Vermehrung von Cyanobakterien, auch Blaualgen genannt, führen regelmäßig zu Badeverboten im Sommer. Für die Stadt Wilhelmshaven ist die Ermittlung der Ursachen der Blüte also von großem Interesse. Der Aufsatz referiert den Stand des Wissens zum Banter See, zu den Cyanobakterien und Wasserblüten und beschreibt Materialgewinnung und Untersuchungsmethoden, die zu verstehen, geschweige denn zu vermitteln, ich völlig außer Stande bin. Kontrollierte Wachstumsexperimente sollen Erkenntnisse über die Faktoren liefern, die die Massenvermehrung der Blaualgen günstig beeinflussen. Die Entwicklung der Bakterien wird im Labor in Abhängigkeit zur Salinität, also zum Salzgehalt des Wassers, zur Nährsalzkonzentration, zur Temperatur sowie zu einer Kombination der Parameter Lichtintensität und Temperatur. Aus den Ergebnissen resultieren Handlungsvorschläge. Einen Königsweg aus der Kalamität gibt es aber leider nicht.
Der Band schließt wie immer mit den Berichten. Dem Nachruf Wolfgang Martens auf den Ihnen bekannten in diesem Jahr verstorbenen vielfach geehrten Apotheker und Familienforscher Wolfgang Büsing folgen die Jahresberichte des scheidenden Vorsitzenden über den Landesverein und erneut von Wolfgang Martens über die von ihm geleitete Oldenburgische Gesellschaft für Familienkunde und schließlich knappe Schilderungen der zahlreichen Studienfahrten, die die regen Aktivitäten des Landesvereins auch auf diesem Feld dokumentieren.
- Klaus- Peter Müller -